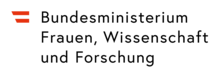Projektleitung gesamt:
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Corinna Koschmieder | PH Steiermark
Projektmitarbeiter:innen:
HS-Prof.in MMag.a Dr.in Priv.-Doz.in Thomas Almut
Prof.in Mag.a Dr.in Strauß Sabine
Prof.in Mag.a Dr.in Jaksche-Hoffmann Elisabeth
Projektmitarbeiter:innen extern:
HS-Prof. Mag. Martin Auferbauer, PhD | PH Steiermark
HS-Prof. Mag. Mathias Krammer, MA PhD | PH Steiermark
Mag. Manfred Herzog MA | PH Steiermark
HS-Prof.in Dr.in Karina Fernandez | PH Steiermark
Laufzeit:
01.01.2026-01.03.2029
Projektbeschreibung:
TALIS (Teaching and Learning International Survey) ist eine weltweite, internationale Studie über das Lernumfeld an Schulen und die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern. Sie wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt und stellt die Perspektive der Lehrpersonen in den Mittelpunkt. Österreich nimmt nach 2008 und 2018 das dritte Mal an TALIS teil. Das Ziel von TALIS ist die Bereitstellung von Indikatoren und Analysen über die Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes Schule. Darüber hinaus ermöglicht TALIS einen Vergleich des schulischen Arbeitsumfelds der teilnehmenden Länder. Insbesondere sollen bei TALIS 2024 neben den Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern folgende Themenbereiche fokussiert werden: Lehrmethoden, -haltungen und -einstellungen sowie Unterricht in heterogenen Lernumfeldern, Arbeitszufriedenheit, Diversität, Nutzung digitaler Technologien und der Einfluss von COVID-19.
Website:
https://talis-oesterreich.at
In der Verlängerung von TALIS sollen Forschungsfragen bearbeitet werden, die eine hohe Relevanz für das österreichische Bildungssystem aufweisen. Ziel ist es, dass die Forschungsergebnisse von TALIS 2024 von Seiten der Pädagog*innen umfassend rezipiert und für die Weiterentwicklung ihrer Unterrichtspraxis und die Schulentwicklung genutzt werden. Damit einher gehen folgende Teilziele:
1. Analyse des Nachhaltigkeitsdatensatzes: Die Daten zum Themenbereich Nachhaltigkeit, die Mitte 2027 veröffentlicht werden, sollen von der Projektgruppe analysiert und publiziert werden. Die Publikation (ca. 30 Seiten) soll als Onlinebeitrag auf der Webseite von TALIS veröffentlicht werden.
2. Wissenstransfer auf allen Ebenen: Durch die Systematisierung und Kategorisierung der Ergebnisse (science to science, science to professionals, science to policy, science to public) werden Maßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt. Ein besonderes Anliegen ist es, Ergebnisse nicht nur für Wissenschaftlerinnen, sondern auch für pädagogische Praktiker*innen, politische Stakeholder und die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
3. Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen: Die Forschungsergebnisse werden gezielt in die Konzeption von Fort- und Weiterbildungsangeboten für Lehrpersonen integriert, um die Relevanz und den praktischen Nutzen zu maximieren.
Forschungspartner:
Pädagogische Hochschule Steiermark (Österreich)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, CERI Centre for Educational Research and Innovation (Frankreich)
Bundesministerium für Bildung und Frauen, Sektion III (Österreich)
IQS – Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (Österreich)
Projektleitung gesamt:
Dr. Peter Pirker / kärnten.museum
Projektleitung intern:
HS-Prof. MMag. Dr. Daniel Wutti, MSc
Projektmitarbeiter:innen:
Amy Burkhardt, BEd
Dr. Helge Stromberger
Dr. Peter Pirker
Lisa Obereder
Laufzeit:
01.01.2025 – 31.12.2027
Projektbeschreibung:
Welche Opfer des Nationalsozialismus in Kärnten/Koroška sind bislang in der wissenschaftlichen Literatur, auf Denkmälern sowie in Datenbanken wenig – oder gar nicht – beschrieben? Und welche Lebens- und Leidensgeschichten von Kärntner NS-Opfern könnten weiterhin in Rahmen kürzerer Opferbiografien für pädagogische Ziele aufgearbeitet werden?
Die Pädagogischen Hochschule widmet sich gemeinsam mit dem kärnten.museum in einem Forschungsprojekt genau diesen Fragen.
Bereits bestehende analoge und digitale Datensammlungen werde im Rahmen des Projekts mit weiteren Datenbanken, vertiefender wissenschaftlicher Literatur und Denkmälern abgeglichen. In weiterer Folge werden neue Kurzbiografien erstellt. Wichtige neue Ergebnisse waren von Mai 2025 bis Oktober 2025 in der Ausstellung „Hinschaun! Poglejmo. Kärnten und der Nationalsozialismus. Koroška in nacionalsocializem“ in Klagenfurt/Celovec zu sehen, 2026 bis 2027 werden weitere detaillierte Opferbiografien erstellt und veröffentlicht.
Projektleitung gesamt:
Prof.in Katharina Maitz, BA BA MA PhD | Pädagogische Hochschule Augustinum
HS-Prof. Dr. Thomas Leitgeb, BEd MA MA | Pädagogische Hochschule Burgenland
Projektleitung intern:
Prof.in Mag.a Corinna Mößlacher, BSc.
Projektmitarbeiter:innen intern:
Mag.a Susanne Breiling, BSc.
Prof.in Mag.a Marina Linder
Prof.in Nora Ulbing, BEd MA
Laufzeit:
01.10.2024-30.09.2028
Fördergeber:
Forum Primar-Projekt
Projektbeschreibung:
Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) stellen das Bildungssystem vor Herausforderungen. Eine Betrachtung der Auswirkungen auf Hochschulebene ist notwendig, um Lösungen für den Umgang mit KI-Tools zu finden. Es besteht dringender Bedarf an systematischer Forschung, die Implementierung und Konsequenzen adressiert. Die Studie soll daher zentrale Aspekte der Nutzung und der Auswirkungen von KI-Tools in der Hochschullehre aus zwei Perspektiven (Studierende, Lehrende) im PHVSO betrachten.
Dazu wird ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, der insbesondere auf Ebene der Lehrenden mittels einer (jährlichen) quantitativen Befragung zu Praktiken und Erfahrungen beim Einsatz von bzw. beim Umgang mit KI-Tools einerseits und qualitativen Interviews zur vertieften Analyse sowie zur Identifizierung von Good Practice Lehr-/Lernkonzepten umgesetzt werden soll.
Für die Studierenden wird eine jährliche, querschnittliche, quantitative Befragung implementiert, um Nutzungsmuster und Erfahrungen zu erfassen sowie Trends festzustellen. Eine zusätzliche Längsschnittanalyse, soll Zusammenhänge von unabhängigen und anhängigen Variablen untersuchen.
Die Analyse dieser multiplen Datenebenen soll es ermöglichen, spezifische Parameter für den Einsatz von KI in der Hochschullehre zu identifizieren und Empfehlungen für die Hochschullehre im PHVSO abzuleiten.
Projektleitung gesamt:
Univ.-Prof. Dr. Hans Karl Peterlini | Universität Klagenfurt
Projektleitung intern:
Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Jaksche-Hoffman
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof. Mag. Florian Kerschbaumer
Prof.in Mag.a Daniela Rippitsch
Laufzeit:
01.10.2024-30.09.2027
Projektbeschreibung:
„Wie wir immer noch Bildung organisieren und Lernmöglichkeiten strukturieren, reicht nicht aus, um friedliche Gesellschaften, einen lebenswerten Planeten und eine gerechte Wohlstandsverteilung zu ermöglichen“, lautet der Befund der UNESCO zu den drängenden Fragen unserer Zeit. Das Projekt „transform2gether“, geleitet von der Universität Klagenfurt in Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen Kärnten, Tirol und Wien, setzt aus dieser Einsicht bei den tragenden Personen von Schule an.
Im Projekt werden Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulsozialarbeiter/innen aus 8 Schulen in Wien, Kärnten und Tirol eingeladen, sich über eigens entwickelte Kurse mit den Möglichkeiten einer demokratischen Schulkultur und den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auseinanderzusetzen. Diese werden anschließend mit den Schülerinnen und Schülern an den Partnerschulen in partizipativen Forschungswerkstätten erprobt. Dabei geht es darum, dass sich die Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen kleine Projekte zur Stärkung von Partizipation und Demokratie an ihrer Schule vornehmen und durch niederschwellige Forschungsmethoden die dadurch angeregten Veränderungen dokumentieren und reflektieren. Begleitet vom Projektteam erkunden die Akteurinnen und Akteure von Schule somit selbst die Potenziale, Barrieren, Widerstände, Konflikte und Lösungsansätze für eine partizipative und demokratische Schule:
- Für eine Schule, in der das richtige Wissen nicht von vornherein vorgegeben ist, sondern gemeinsam exploriert wird.
- Für eine Schule, in der Regeln nicht verordnet, sondern ausgehandelt werden.
- Für ein Schulleben, das von allen Beteiligten in Verantwortlichkeit und Mitbestimmung gestaltet wird.
Es geht im Projekt dabei nicht um perfekte Umsetzungen, sondern um ein Lernen aus den Erfahrungen, etwa aus dem Aufspüren von Widerständen, aus der Bearbeitung von Konflikten und auch aus Misslingen und Scheitern. Eine Resonanzgruppe, in die neben Lehrkräften und Schulleitungen auch Schüler*innen einbezogen werden, wird über den gesamten Projektzeitraum hinweg immer wieder um Feedback gebeten. Durch partizipative Forschungsmethoden tragen alle Beteiligten zu einem ständigen Lernen über Potenziale und Grenzen einer demokratischen und partizipativen, also inklusiven und Teilhabe ermöglichenden Schule bei. Auf diese Weise soll mit dem Projekt ein Expertise-Netzwerk von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Schulleitungen und anderen Akteurinnen und Akteuren von Schule entstehen.
Die Erkenntnisse fließen in einer digitalen Kompetenz-Plattform zusammen und werden allgemein zur Verfügung gestellt. Diese Kompetenz-Plattform wird auch nach Projektabschluss als digitaler Ort der Dokumentation und des Austausches vom Projektteam weitergeführt, mit der Möglichkeit der Mitwirkung der beteiligten Schulen. Die Grundidee des Projektes soll sich auf diese Weise auch über den Projektzeitraum hinaus weiter ausbreiten – nämlich, dass die dringend benötigten Veränderungen im Verhalten von Menschen miteinander und gegenüber Natur und Umwelt – die sogenannte große Transformation – der Arbeit im Kleinen sowie der Ermutigung durch Erprobung und Erfahrung bedürfen. Vom Ausloten dessen, was möglich ist und was noch schwierig ist, wird jenes berühmte Lernen erhofft, das nicht für die Schule, sondern fürs Leben seinen Wert entfaltet.
Projektleitung:
HS-Prof.in DDr.in Karin Sonnleitner, MA
Laufzeit:
01.03.2024-28.02.2027
Projektbeschreibung:
Die Zielsetzung des Forschungsprojekts besteht (1) in der datenbasierten Begleitung der Konzeptionsarbeit des Exzellenzprogramms. Die Begleitung gründet sich auf den zwei Paradigmen der Inventionsforschung und der quantitativen Forschung. Damit erfolgt eine gesamte Prozessevaluation mit einer wissenschaftlichen Rahmung. Die Evaluation erfolgt nicht erst nach Abschluss des Programms, sondern die Entwicklung wird durch diesen partizipativen Ansatz von Beginn an mit einer Bedarfserhebung mit dem Einsatz unterschiedlicher empirischer Methoden begleitet, die alle Stakeholder beginnend mit den Schulleitungen selbst, der Bildungsdirektion, der Personalvertretung der Pflichtschullehrer:innen, des Rektorats der Pädagogischen Hochschule im Allgemeinen und des Zentrums für Leaderships und Management der PHK im Besonderen einbezieht.
Daraus entsteht (2) das Exzellenzprogramm, in dem der Fokus auf die etablierten Schulleitungen liegt, die zumindest fünf Jahre Berufserfahrung haben. Auf diese Weise können Erfahrungen aus der Forschung, Lehre und Praxis direkt in die Programmentwicklung einfließen, wobei das Exzellenzprogramm nach Durchführung des ersten Zyklus evaluiert wird.
Projektleitung:
Prof.in Marie-Helen Kitz, MA BA
Laufzeit:
10.06.1024-01.10.2026
Projektbeschreibung:
Das Vorhaben beschäftigt sich mit der zukünftigen Studierbarkeit an der Universität Klagenfurt. Im Fokus der Arbeit steht die Analyse von Expertisen, um bestehende Herausforderungen und Barrieren in der Studierbarkeit zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge abzuleiten. Die zentrale Fragestellung bezieht sich darauf, wie Expert:innen die Entwicklung der Studierbarkeit an der Universität einschätzen und welche Maßnahmen zur Optimierung nötig sind. Das Vorhaben verfolgt das Ziel, zur wissenschaftlichen Diskussion beizutragen und konkrete Impulse für die Studiengestaltung zu liefern.
Im Zentrum steht die Perspektive der Studienprogrammsleitungen (SPL) sowie der Studierendenvertretungen. Die Erhebung folgt einem Delphi-Design, das in zwei Erhebungswellen durchgeführt wird. In der ersten Welle werden Einschätzungen zur aktuellen Situation, zentralen Einflussfaktoren sowie bestehenden Herausforderungen der Studierbarkeit gesammelt. In der zweiten Welle erfolgt eine Vertiefung dieser Ergebnisse: Mögliche Maßnahmen, Zukunftsperspektiven sowie Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Studierbarkeit werden gemeinsam diskutiert und priorisiert.
Ziel des Projektes ist es, durch die Kombination institutioneller und studentischer Perspektiven ein differenziertes Bild der Studierbarkeit an der Universität Klagenfurt zu erhalten und konkrete Empfehlungen für deren Weiterentwicklung abzuleiten. Die Ergebnisse sollen nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, sondern auch einen praktischen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre leisten.
Projektleitung gesamt:
HS-Prof. Mag. Dr. Huber Matthias
Projektleitung intern:
HS-Prof. Mag. Dr. Huber Matthias
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Christine Haupt, MA Bed
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Gabriele Beer | KPH Wien/Niederösterreich
HS-Prof.in Dr.in Angela Forstner-Ebhart, MEd | HAUP Wien
VR HS-Prof.in Dr.in Anne Frey | PH Vorarlberg
DIin Pia Glaeser, Bakk. rer. nat. BEd BEd MEd | PH Niederösterreich
Rektorin HS-Prof.in Mag.a Elisabeth Haas, BEd PhD | PH Vorarlberg
Prof.in Mag.a Maria Hochwarter | KPH Edith Stein
HS-Prof.in Mag.a Christina Imp | PH Tirol
HS-Prof. Mag. Dr. David Kemethofer | PH Oberösterreich
Prof.in Dr.in Smirna Malkoc, BSc MSc | PH Steiermark
HS-Prof. Dr. Herbert Neureiter, BEd | PH Salzburg
Prof.in Mag.a Dr.in Susanne Oyrer, BEd | PPH Linz
Prof.in Dr.in Sylvia Potzmader, BEd MEd MA | KPH Wien/Niederösterreich
IL Prof.in Silvia Pichler, BEd MEd | PH Vorarlberg
Prof.in Mag.a Petra Rauschenberger, BEd | PH Wien
Prof. Mag. Klaus Schneider, PhD | PH Tirol
Prof.in Mag.a Dr.in Julia Seyß-Inquart | PPH Augustinum
HS-Prof.in Dr.in Elisabeth Stipsits, BEd MEd MA | PH Burgenland
Prof.in Mag.a Hannelore Zeilinger MEd | PH Niederösterreich
Laufzeit:
01.01.2023-31.12.2028
Projektbeschreibung:
Der Berufseinstieg gilt im Allgemeinen als eine zentrale Stellgröße im Kontext der Bildungsbiografie von Lehrpersonen. In dieser Phase werden Lehrer*innen mit vielfältigen Berufsaufgaben, neuen Lebensumständen und bisher unbekannten Verantwortungsbereichen konfrontiert. Dabei nehmen die in der Berufseingangsphase gemachten Erfahrungen wesentlichen Einfluss auf die Vorstellung von Unterricht(squalität) und prägen die Entwicklung des eigenen, professionellen Selbstverständnisses als Lehrperson nachhaltig. Die Qualität des Berufseinstiegs ist dabei von unterschiedlichen individuellen und kontextuellen Faktoren abhängig. Hierzu zählen mitunter (Aus-)Bildung, Studium und berufsrelevante Vorerfahrungen, Persönlichkeit und Charakter der Lehrperson, Begleitung und Unterstützung während des Berufseinstiegs, emotionales Erleben und Motivation der Berufseinsteiger*innen, (Fach-)Kollegium und Schulleitung, soziale Eingebundenheit und adäquate soziale Unterstützungssysteme sowie der Schulstandort und damit einhergehende strukturelle Ausgangsbedingungen. Allerdings ist es nach wie vor unklar, unter welchen Bedingungen der Berufseinstieg gelingt und zur Zufriedenheit führt bzw. welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen es tatsächlich braucht, um den Einstieg in den Lehrer*innenberuf als Chance und als positiv konnotierte, konstitutive Erfahrung für den weiteren Lebensweg als Lehrer*in wahrzunehmen. Dies liegt mitunter auch an den wechselnden gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie den allgemeinen gesellschaftlichen Transformationsprozessen der letzten Jahre. So hat sich nicht nur die Ausbildung von Lehrpersonen, die entsprechenden Curricula in Primar- und Sekundarstufe sowie das eigentliche Berufseinstiegsmodell in Österreich immer wieder verändert, sondern auch die Anforderungen an den Beruf Lehrer*in sind durch aktuelle, gesellschaftliche Veränderungen komplexer und vielfältiger geworden. Dementsprechend widmet sich das hier vorgestellte Forschungsprojekt der Frage, welche Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Anforderungen einen gelingenden Einstieg in den Beruf als Lehrperson in Österreich begünstigen und welche Implikationen sich daraus für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie für die Gestaltung eines gelingenden Berufseinstiegs in Österreich ergeben.
Fördergeber:
Das Forschungsprojekt wird von der „Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen Österreich“ (RÖPH) gefördert. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von allen 14 Rektor:innen der Pädagogischen Hochschulen Österreich unterzeichnet.
Projektleitung gesamt:
Ass.-Prof.in Dr.in Nadja Thoma | Universität Innsbruck
Projektleitung intern:
IL Prof.in Mag.aAngerer-Pitschko Magdalena
Prof.in Mag.a Dr.inJennifer Kresitschnig
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Mag.aElisabeth Nuart, BA
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Verena Platzgummer | EURAC Research (Co-Leitung)
Sabine Krause | Universität Innsbruck
Nataša Ottowitz | Universität Klagenfurt
Brigitta Busch | Universität Wien
Alfonso Del Percio | UCL Institute of Education University College London
Yasemin Karakaşoğlu | Universität Bremen
Sascha Neumann | Universität Tübingen
Laufzeit:
01.04.2023-31.03.2026
Projektbeschreibung:
Wie können Kinder in mehrsprachigen Kindergruppen bei ihrem Spracherwerb unterstützt werden? Und wie kann es gelingen, das gesamte sprachliche Repertoire aller Kinder zu fördern? Mehrsprachigkeit im Kindergarten ist ein gesellschaftlich und bildungspolitisch hoch relevantes Thema, dem auch besondere Bedeutung für den Übergang in die Schule zugeschrieben wird. Elementarpädagog*innen haben die komplexe Aufgabe, Kinder in ihren Deutschkompetenzen zu stärken und ihre Zwei- und Mehrsprachigkeit zu fördern. Um mehr über Möglichkeiten und Herausforderungen dieser pädagogischen Arbeit zu erfahren, wird das Projekt Mehrsprachigkeit in der pädagogischen Professionalisierung von Elementarpädagog*innen umgesetzt. Zwei Gruppen unterstützen das wissenschaftliche Team: Schüler*innen einer berufsbildenden höheren Schule für Elementarpädagogik führen im Rahmen ihrer Praktika kleine ethnographische Studien in Kindergärten durch, und Elementarpädagog*innen, die in Kärntner und Südtiroler Kindergärten arbeiten, bringen ihre Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit und sprachlicher Bildung aus ihrer Arbeit im Kindergartenalltag ein. Die gewonnenen Daten bilden die Basis für neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Ausbildung von Elementarpädagog*innen in zwei- und mehrsprachigen Kontexten sowie in Migrationsgesellschaften. Zudem werden Empfehlungen für die pädagogische Praxis formuliert und ein Weiterbildungskonzept für Elementarpädagogik in zwei- und mehrsprachigen Regionen entwickelt.
Fördergeber:
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, BMBWF - OeAD
Projektleitung gesamt:
PH Vorarlberg
Projektleitung intern:
HS-Prof. MMag. Dr. Daniel Wutti, MSc
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Mag.a Astrid Mairitsch, PhD
Esma Murić
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Mitarbeiter:innen aller PHen in Österreich
Laufzeit:
01.09.2023-01.12.2025
Projektbeschreibung:
Die Jugendstudie „Lebenswelten. Einstellungen und Werte von Jugendlichen in Österreich“ wird auch 2025 erneut durchgeführt. Die repräsentative Studie gibt Einblicke in die unterschiedlichen Lebenswelten junger Menschen und fokussiert die Fragen: Was hat sich bei jungen Menschen in Österreich seit dem Jahr 2020 verändert? Wie sehen sie nach den Jahren der Pandemie und angesichts von Krieg und Klimakrise ihre Zukunft? Was ist ihnen wichtig? Wie sehen sie das gesellschaftliche Zusammenleben? Wie wichtig ist ihnen ihre schulische Ausbildung? Was tun sie in ihrer Freizeit und welche Erwartungen haben sie an ihren künftigen Beruf? Zielgruppe sind Jugendliche der 8. bis 12. Schulstufe. In diesem Alter stellen sich Jugendliche ihren Entwicklungsaufgaben, festigen ihre Werte und machen sich konkrete Gedanken zu ihrem zukünftigen Lebensweg.
An der Studie beteiligen sich alle Pädagogischen Hochschulen Österreichs. Die Erhebungen werden im Klassenverband in allen Schultypen geplant. Die Stichprobe für die Bundesländer wird mit Unterstützung der Statistikabteilung des Landes Vorarlberg erstellt. Pro Bundesland wird eine Beteiligung von rund 1.500 Schüler:innen angestrebt. Schulen, Pädagog:innen, Bildungsdirektionen, Jugendreferate und alle, die beruflich oder privat mit Jugendlichen zu tun haben, profitieren von den Ergebnissen.
Die Daten der Jugendstudie werden im Rahmen einer standardisierten Online-Befragung erhoben. In allen teilnehmenden Bundesländern kommt ein gemeinsamer Kernfragebogen zum Einsatz. Themenfelder sind Freizeit, Freund:innen, Beruf, Zukunftsperspektiven, Ängste, Wertorientierungen, Partnerschaft, Religion, Gesundheit, Politik, Zusammenleben, schulisches Wohlbefinden und Unterricht. Zudem gibt es in jedem Bundesland Fragen zu einem der drei thematischen Schwerpunkte Futures Literacy, Diversität oder Teilhabe). Ergänzend wird eine qualitative Vertiefungsstudie durchgeführt.
Fördergeber:
Pädagogische Hochschulen in Österreich
Projektleitung:
HS-Prof.in MMag.a Dr.in Priv.-Doz.in Thomas Almut
Projektmitarbeiter:innen intern:
HS-Prof.in MMag.a Dr.in Karin Herndler-Leitner, BEd
HS-Prof. Reg.-Rat Mag. Dr. Erik Frank
Prof.in Mag.a Daniela Wernisch, BEd
Prof. MMag. Dr. Dipl.Päd. Peter Gurmann
Prof.in Anna Gablier, BEd MA
Laufzeit:
01.10.2023-30.09.2027
Projektbeschreibung:
Inklusive Schulklassen stellen Lehrkräfte häufig vor besondere Herausforderungen. Besonders der Unterricht mit Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, auffälligem Verhalten oder hohem Migrationsanteil wird als belastend erlebt (MacFarlane & Woolfson, 2013; Savolainen et al., 2012; Schwab & Seifert, 2015). Gleichzeitig sind Lehrkräfte in vielen Ländern stark von Stress und Burnout betroffen (Wettstein et al., 2021). Um eine positive Entwicklung der Schüler:innen und das Wohlbefinden der Lehrkräfte zu sichern, sind Strategien zur Bewältigung solcher Situationen zentral.
Das Projekt verfolgt das Ziel, herausfordernde Unterrichtssituationen und adaptive Verhaltensweisen von Lehrkräften zu identifizieren. Theoretische Grundlage bildet die Selbstbestimmungstheorie (SDT; Ryan & Deci, 2020), die die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit als Basis für Motivation, Wohlbefinden und Leistungsentwicklung beschreibt. Lehrkräfteverhalten, das diese Bedürfnisse unterstützt, wird als motivierender Unterrichtsstil bezeichnet und gilt auch in schwierigen Situationen als adaptiv (Aelterman et al., 2019; Reeve & Cheon, 2021).
Das Projekt umfasst drei Phasen: (1) Narrative Interviews mit Lehrkräften dienen der Sammlung realer, als herausfordernd erlebter Situationen. Daraus werden ca. 30 Vignetten entwickelt. (2) In Gruppendiskussionen mit erfahrenen Lehrkräften werden mögliche Reaktionen erarbeitet und theoriegeleitet kategorisiert. (3) Die Validierung der Vignetten erfolgt mit ca. 150 Lehrkräften und 150 Lehramtsstudierenden, u. a. durch Konstrukt- und Kriteriumsvalidität. Zusätzlich wird in Fokusgruppeninterviews mit Lehramtsstudierenden geprüft, ob die Vignetten Lernprozesse in der Lehrerbildung anregen.
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Forschung über adaptive Lehrerstrategien in inklusiven Kontexten und schafft praxisnahe Instrumente für Forschung, Aus- und Weiterbildung.
Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Haerens, L., Soenens, B., Fontaine, J. R. J., & Reeve, J. (2019). Toward an integrative and fine-grained insight in motivating and demotivating teaching styles: The merits of a circumplex approach. Journal of Educational Psychology, 111(3), 497–521. https://doi.org/10.1037/edu0000293
MacFarlane, K., & Woolfson, L. M. (2013). Teacher attitudes and behavior toward the inclusion of children with social, emotional and behavioral difficulties in mainstream schools: An application of the theory of planned behaviour. Teaching and Teacher Education, 29, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.08.006
Reeve, J., & Cheon, S. H. (2021). Autonomy-supportive teaching: Its malleability, benefits, and potential to improve educational practice. Educational Psychologist, 56(1), 54–77. https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1862657
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Press.
Savolainen, H., Engelbrecht, P., Nel, M., & Malinen, O. P. (2012). Understanding teachers’ attitudes and self-efficacy in inclusive education: Implications for pre-service and in-service teacher education. European Journal of Special Needs Education, 27(1), 51–68. https://doi.org/10.1080/08856257.2011.613603
Schwab, S., & Seifert, S. (2015). Auswirkungen von schulischer Inklusion auf die Einstellung von Lehrkräften in Österreich. Empirische Pädagogik, 29(2), 211–229.
Wettstein, A., Scherzinger, M., & Ramseier, E. (2021). Unterrichtsqualität und Lehrergesundheit: Empirische Befunde zu Belastung, Beanspruchung und Ressourcen. Zeitschrift für Pädagogik, 67(2), 223–244.
Projektleitung:
HS-Prof.in MMag.a Dr.inMartina Greiler
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Mag.a Dipl.-Ing.in Tanja Lobnig
HS-Prof.in MMag.a Dr.in Priv.-Doz.in Thomas Almut
Laufzeit:
01.10.2023-30.09.2026
Projektbeschreibung:
In dem Forschungsprojekt wird das fachliche und fachdidaktische Wissen zum halbschriftlichen Multiplizieren in der Primarstufe bei drei Gruppen untersucht: Studienanfänger:innen, Studierende in der zweiten Ausbildungsphase des Primarstufenlehramts und berufstätige Lehrpersonen.
Das halbschriftliche Multiplizieren ist eine zentrale Rechenmethode der Primarstufe zur Bewältigung mehrstelliger Multiplikationen. Es ermöglicht Kindern, Einsicht in grundlegende Rechengesetze und mathematische Zusammenhänge zu erlangen und Rechenstrategien flexibel und aufgabenadäquat einzusetzen. In der schulischen Praxis wird diese Rechenmethode jedoch oft lediglich als Vorstufe des schriftlichen Verfahrens angesehen und nach der Einführung der schriftlichen Algorithmen kaum mehr weitergeführt.
Damit Lehrkräfte Kinder beim Entwickeln aufgabenadäquater halbschriftlicher Strategien begleiten können, benötigen sie fundiertes fachliches und fachdidaktisches Wissen. Sie müssen beispielsweise wissen, wie Inhalte verständlich gemacht, typische Vorstellungen von Schüler:innen erkannt und geeignete Aufgaben- und Erklärungsformate genutzt werden können.
Vor diesem Hintergrund ist es bedeutsam, das Wissen von (angehenden) Lehrkräften systematisch zu erfassen. So lässt sich nachvollziehen, wie es sich im Verlauf des Studiums entwickelt und in der Berufspraxis stabilisiert oder verändert.
Die Datenerhebung erfolgt mithilfe eines qualitativ ausgerichteten Fragebogens auf Basis des COACTIV-Modells. Anhand inhaltlicher Fragestellungen zum halbschriftlichen Multiplizieren werden bei rund 200 Teilnehmenden aus den drei Gruppen Subfacetten wie fachliches Wissen, Erklärungswissen, Wissen über mathematisches Denken von Schüler:innen und Wissen über mathematische Aufgaben erfasst. Die Antworten werden qualitativ kodiert und durch deskriptive statistische Verfahren ergänzt. Die Ergebnisse liefern empirische Evidenzen für die curriculare Validität der Lehrer:innenausbildung und sollen zeigen, wie sich fachliches und fachdidaktisches Wissen im Verlauf von Ausbildung und Berufspraxis entwickelt.
Projektleitung:
Dr.in Mag.a Josefine Scherling, MA
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Dr.in Mag.a Ursula Maurič, MA (PH Wien)
Laufzeit:
01.10.2023-30.09.2026
Projektbeschreibung:
In einem früheren Forschungsprojekt der beiden Forscher:innen (2018 - 2022) stand die Frage im Mittelpunkt, welche Orientierungspunkte für gute hochschulische Lehre zu GCE im Kontext der Ausbildung von Lehrpersonen identifiziert werden können. Ein besonderer Schwerpunkt galt dem Konzept der kognitiven Gerechtigkeit. Aufbauend auf den daraus gewonnenen Ergebnissen rückt dieses Follow up Projekt nun die Herausforderungen, die sich für Institutionen der Lehrer:innenbildung aus globalen Vorstellungen von Bildung ergeben, stärker in den Mittelpunkt. Es geht demnach in der Lehrer:innenbildung darum, kritische Zugänge zu finden, die den lokalen gesellschaftspolitischen Herausforderungen in der Bildung adäquat begegnen, indem sie immer auch den Bezug zu globalen Entwicklungen herstellen. Am Beispiel von GCE lässt sich dies gut illustrieren.
Das Projekt hat drei maßgebliche Ziele: (1) Konzepte einer kritischen GCE werden unter besonderer Berücksichtigung der lokalen, geopolitischen Position für Lehrer:innenbildung an Pädagogischen Hochschulen in Österreich diskutiert und geschärft. (2) Die kritische Dimension von GCE und ihre Bedeutung allgemein für hochschulische Lehre wird am Beispiel ausgewählter Schwerpunktbereiche expliziert (kritische Medienbildung, globale Zukunftsbilder, migrationsgesellschaftliche Aspekte der Lehrer:innenbildung). (3) Schließlich werden hochschuldidaktische Schlussfolgerungen für die Umsetzung einer kritischen GCE an Pädagogischen Hochschulen in Österreich abgeleitet.
Der Erkenntnisgewinn wird u.a. aus einer hermeneutisch-interpretativen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Konzepten von GCE mit besonderem Fokus auf deren kritische Dimension erfolgen. Dies geschieht mittels kritischer Theorien wie z. B. postkoloniale Kritik, Neoliberalismuskritik, Rassismuskritik, feministische Theorien, kritische Bildungstheorien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Implikationen, die sich daraus allgemein für Hochschuldidaktik ergeben.
Projektleitung:
Prof.in Eva Hartmann, BEd MA
Laufzeit:
01.10.2023-30.09.2026
Projektbeschreibung:
Das geplante Dissertationsprojekt widmet sich aktuellen Forschungsfragen zur slowenischen Volksgruppe – einer der sechs offiziell anerkannten autochthonen Volksgruppen in Österreich – im südlichsten Bundesland Österreichs, Kärnten/Koroška. Zunehmend komplexe Sprachbiografien von Lernenden sind eine (schulische) Realität – auch im Minderheitenschulwesen (Buchwald, Hartmann & Wutti, 2023). Das spezifische Forschungsinteresse des geplanten Dissertationsprojekts ergibt sich daher aus der Tatsache, dass das Minderheitenschulwesen in Kärnten längst nicht mehr ausschließlich der Bildung von Angehörigen der slowenischen Volksgruppe dient, sondern mittlerweile als regionales Bildungsangebot für Schüler:innen mit sehr unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen genutzt wird. Diese Situation stellt einerseits pädagogische und bildungspolitische Herausforderungen dar; andererseits birgt diese Entwicklung auch Potenzial für die Präsenz und (Re)Vitalisierung des Slowenischen in Kärnten/Koroška. Das geplante Dissertationsprojekt untersucht diese neuen Gruppen von Slowenisch-Sprecher:innen und -Lernenden im Minderheitenschulwesen Kärntens und möchte somit zur Schließung einer Forschungslücke beitragen, welche bislang wenig wissenschaftliche Beachtung gefunden hat. Als methodischer Zugang zur Datenerhebung werden leitfadengestützte Interviews mit Schüler:innen des BG/BRG für Slowenen / ZG/ZRG za Slovence in Klagenfurt/Celovec durchgeführt, die zwar das Minderheitenschulwesen besuchen, sich jedoch nicht selbst als Angehörige der „traditionellen Kerngruppe“ der slowenischen Volksgruppe in Kärnten definieren. Zentrale Themen der Befragung widmen sich der Sprachnützung, des Sprachenlernens und der Sprachentwicklung sowie Fragen der (Nicht)Zugehörigkeit.
Gewonnene Forschungserkenntnisse fließen in den fachlichen Arbeitsbereich Mehrsprachigkeit, Minderheitensprachen und Transkulturelle Bildung an der Pädagogischen Hochschule Kärnten ein und sollen weitere forschungsbasierte Dimensionen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen des Minderheitenschulwesens in Kärnten beitragen.
Literatur:
Buchwald, S., Hartmann, E. & Wutti, D. (2023). »Mit meiner Mama rede ich Italienisch, mein Vater redet mit mir Slowenisch, aber ich antworte meistens auf Deutsch«. In Informationen zur Deutschdidaktik IDE, 4-2023 (S. 44-57).
Projektleitung:
Dr.in Mag.a Josefine Scherling, MA
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Dr.in Tuija Kasa (University of Helsinki)
Laufzeit:
01.10.2023-30.09.2026
Projektbeschreibung:
Dieses Forschungsprojekt befasst sich mit dem Konzept des Widerstands als zentrales Element einer kritischen Menschenrechtsbildung zur Förderung von Demokratie. Während globale Herausforderungen vielfältige Widerstands- und Protestbewegungen hervorbringen, bleibt das Konzept des Widerstands in wissenschaftlichen Diskursen zur Menschenrechtsbildung unterentwickelt und wird alltagssprachlich zumeist als bloße Gegnerschaft verstanden. Widerstand ist dabei eng mit der Geschichte und Entwicklung der Menschenrechte verbunden, da grundlegende Menschenrechte oftmals als Antwort auf Akte des Widerstands gegen Unterdrückung und Unrecht errungen wurden.
Im Kern untersucht das Projekt die Frage, wie Widerstand als Element von kritischer Menschenrechtsbildung konzeptualisiert werden kann, um Demokratie zu fördern. Dabei werden sowohl die Potenziale von konstruktivem Widerstand zur Herausforderung marginalisierender Strukturen als auch die Komplexitäten und Grenzen von Widerstand in demokratischen und nicht-demokratischen Kontexten erkannt. Das Forschungsteam analysiert, wie kritische Menschenrechtsbildung mit Widerstand als tragendem Element dazu beiträgt, dominante Diskurse, Ungerechtigkeit und Unterdrückung sichtbar zu machen, gleichzeitig aber auch die eigenen blinden Flecken und hegemonialen Dimensionen von Menschenrechtsbildung zu reflektieren.
Die methodische Herangehensweise basiert auf einer konzeptionellen Analyse, angelehnt an kritische Theorie sowie an Zugänge aus den Resistance Studies. Im Zentrum steht die theoretische Beleuchtung relevanter Begriffe und Positionen. Daraus soll ein differenzierter Zugang zu Widerstand im Kontext einer kritischen Menschenrechtsbildung entwickelt werden. Unter Bezugnahme auf wissenschaftliche Demokratie(bildungs)-Diskurse werden die daraus entstandenen Erkenntnisse unter dem Blickwinkel von Demokratieförderung kritisch reflektiert.
Die Erkenntnisse werden in forschungsgeleitete Lehre in der Lehrer:innenbildung integriert, um zukünftige Pädagog:innen dabei zu unterstützen, ethisch komplexe Themen von Ungerechtigkeit und demokratische Widersprüche im Unterricht differenzierter zu behandeln.
Projektleitung gesamt:
Prof.in Mag.a Christine Prochazka, BEd MA
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Prof.in Dr.in Mag.a Bakk. Monika Raffelsberger-Raup
Laufzeit:
01.10.2023-28.02.2026
Projektbeschreibung:
Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines innovativen Lernraums, der neue Formen des Lehrens und Lernens im Bereich literaler Kompetenzen im Fach Deutsch fördert. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass exzellente Bildung moderne, flexible Lernumgebungen erfordert, um Zukunftskompetenzen nachhaltig zu vermitteln (vgl. Groß 2022). Wie Messner et al. (2009) betonen, genügt es in der Lehrer*innenbildung nicht mehr, Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln. Stattdessen sind selbstgesteuerte Lernprozesse und aktivierende Lernräume notwendig, die Studierende zur Eigenverantwortung und Reflexion befähigen (vgl. Rummler 2014; Günther et al. 2019).
Das Projekt reagiert auf diese Anforderungen durch die Konzeption und Implementierung des Lernraums Literacy an der PHK. Dabei werden physische und virtuelle Lernumgebungen zu einer ganzheitlichen Lernarchitektur verbunden. Mediengestützte Lernarrangements unterstützen laut van Ackeren et al. (2017) Selbststeuerung, Kooperation und individuelle Lernwege und bilden damit die Grundlage des Konzepts.
Der Lernraum Literacy wird mit flexiblem Mobiliar und moderner Technologie ausgestattet, um vielfältige Lernsettings und die Förderung digitaler Schlüsselkompetenzen zu ermöglichen (vgl. Dondi et al. 2021). Studierende sollen innovative Unterrichtsszenarien erproben, ihre Ergebnisse in die Schulpraxis übertragen und ihre Fähigkeit zum lebenslangen Lernen stärken. Das Projekt trägt so zu einer zukunftsorientierten, lernendenzentrierten Hochschulkultur im Fach Deutsch bei.
Projektleitung:
Prof.in Mag.a Dipl.-Ing.inTanja Lobnig
Laufzeit:
01.10.2023-30.09.2027
Projektbeschreibung:
Der Kompetenzbereich Größen zählt zu den vier inhaltlichen mathematischen Kompetenzbereichen der Volksschule und umfasst die Größenbereiche Länge, Gewicht (Masse), Volumen, Zeit(spanne), Geld(wert) und Fläche. Ziel des Unterrichtes ist der „Aufbau tragfähiger Grundvorstellungen“ (Größen und Messen, o. D.) sowie der „sachadäquate Umgang“ (Franke & Ruwisch, 2010, S. 177) mit ihnen.
Die Entwicklung von Größenvorstellungen stellt jedoch einen komplexen Prozess dar. Jedes Kind entwickelt, geprägt durch seine Umwelt und seine Vorerfahrungen, individuelle, subjektive Vorstellungen von Größen, Maßeinheiten und deren Beziehung zueinander. Diese Vorstellungen bilden die Grundlage für einen sicheren Umgang mit Maßeinheiten, der unabdingbar für den gesamten weiterführenden MINT-Unterricht ist.
Gleichzeitig zählt das Arbeiten mit Größen zu den Themen der Primarstufenmathematik mit den größten Lernschwierigkeiten (Nührenbörger, 2002). Insbesondere das Umwandeln von Maßeinheiten stellt sowohl für Schüler:innen als auch für Studierende eine besondere Herausforderung dar (z. B. Lassnitzer & Gaidoschik, 2019). Dafür sind vielfältige Voraussetzungen nötig, wie beispielsweise ein Verständnis des Dezimalsystems, Stützpunktvorstellungen zu Einheiten, etc.
Während bisherige Studien vor allem mathematische Kompetenzen (z. B. IKMplus) und didaktische Ansätze (z. B. Schmitz & Fahse, 2017) zum Thema Umwandeln von Maßeinheiten erhoben haben, gibt es kaum Forschung zu den subjektiven Vorstellungen der Kinder beim Umwandeln von Maßeinheiten. Dieses Forschungsvorhaben setzt genau hier an und untersucht, welche subjektiven Vorstellungen Kinder beim Umwandeln von Einheiten in den Größenbereichen Länge und Gewicht (Masse) entwickeln.
Projektleitung:
Prof.in Mag.a Dr.inElisabeth Niederer
Projektmitarbeiter:innen:
Prof.in MMag.a Birgit Albaner
Prof.in Mag.a Andrea Embacher
Prof. Ing. Norbert Jäger, BEd MA
Prof.in Marie-Helen Kitz, BA MA
Prof.in Mag.a Christine Kohlweis-Peternel
Prof.in Mag.a Gerda Ogris-Stumpf, BEd
Prof.in Dipl.Päd.in Gabriele Pließnig, MEd BEd
Prof. Dipl.Päd. Mag. Frank Telsnig, BEd
Laufzeit:
01.10.2023-30.09.2026
Projektbeschreibung:
Schule hat auch Bildungs- und Erziehungsaufgaben, die nicht nur einzelnen Unterrichtsgegenständen zugeordnet werden können. Diese sind in den Lehrplänen verankert und als Unterrichtsprinzipien im Unterricht aller Gegenstände der jeweiligen Schulart zu berücksichtigen. Eines dieser übergreifenden Themen ist das Unterrichtssprinzip Wirtschafts- und Verbraucher:innenbildung. Wirtschaft und Konsum sind in unserer Gesellschaft sehr zentrale Handlungs- und Kommunikationsfelder; sie bestimmen das Selbst- und Fremdverständnis von Einzelnen entscheidend mit. Schüler:innen sollen wirtschaftliche Kompetenzen zur Bewältigung der Rollen als Konsumierende, Geldanlegende, Kredit- oder Versicherungsnehmer:innen vermittelt werden.
Diese Studie soll einen ersten Einblick in die Anwendung und die Akzeptanz dieses Themas sowie die Voraussetzungen bei den Lehrer:innen gewinnen, um Rückschlüsse für die Planung der Fort-und Weiterbildung ziehen zu können.
Projektleitung: Radmann Diana
Laufzeit: 01.10.2023-01.10.2026
Projektleitung: Unger Alexandra
Laufzeit: 01.10.2023-01.10.2026
Projektleitung gesamt:
Assoc. Prof. Dr. Florian Müller, M.A., Universität Klagenfurt
Prof.in Dr.inChristine Ragginer, Bakk.rer.nat. MSc., Pädagogische Hochschule Kärnten
Postdoc-Ass.in Mag.a Dr.in Carina Spreitzer, Universität Klagenfurt
Projektleitung intern:
Prof.in Dr.inChristine Ragginer, Bakk.rer.nat. MSc.
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Mag.a Dr.in Heike Demarle-Meusel
HS-Prof. Mag. Dr. Bernhard Schmölzer
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Univ.-Ass. Mario Udo Kaiser, BSc.MSc., Universität Klagenfurt
Crispin Hoppe, Studienassistent, Universität Klagenfurt
Michael Kaufmann, BSc, Studienassistent, Universität Klagenfurt
Laufzeit:
01.08.2022-31.12.2027
Projektbeschreibung:
Die österreichweite Bildungsinitiative „Innovationen machen Schulen top!“ (IMST) wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) mit der Evaluation und Begleitforschung (Arbeitspaket 3, AP3) des Schulversuchs MINT-Mittelschule, der im Schuljahr 2022/2023 startete, beauftragt. An 57 ausgewählten österreichischen Mittelschulen wird “MINT”, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Design, im Pilotprojekt MINT-MS als neuer fächerübergreifender und projektorientierter Unterrichtsgegenstand geführt.
Im Projekt „IMST Arbeitspaket 3 – Evaluation und Begleitforschung zu MINT-MS - Unterricht, Motivation, Emotion und Kompetenzen in den MINT-MS“ werden die schulischen Rahmenbedingungen und die Qualität des MINT-Unterrichts erhoben und diese mit den damit einhergehenden kognitiven und affektiven Outcomes im Zusammenhang untersucht.
Ziel der Evaluation und der Begleitforschung ist es, Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung eines MINT-Curriculums zu identifizieren, wissenschaftlich abgesicherte Handlungsoptionen zu formulieren und möglichst generalisierbares wissenschaftliches Wissen zu generieren. Zudem werden den Schulen jährlich in kompakter Form die Ergebnisse der Evaluation und Begleitforschung zur Verfügung gestellt, um diese für die Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung zu nutzen.
Weitere Informationen finden sich unter: https://www.imst.ac.at/forschungsdesign/


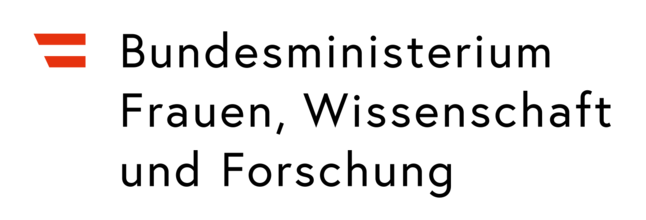
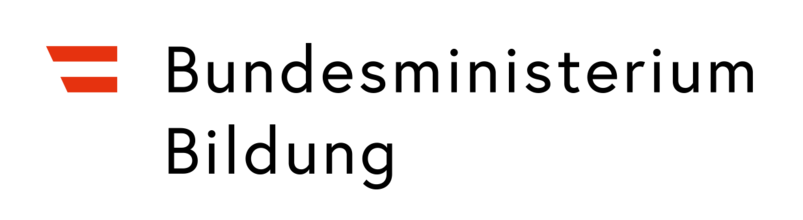
Projektleitung gesamt:
Prof.in Mag.a Dr.inRaffelsberger-Raup Monika Bakk.
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Assoc. Prof.in Dr.in Nicola Mitterer | AAU
Laufzeit:
01.10.2023-28.02.2026
Projektbeschreibung:
Das Projekt ist eine Interventionsstudie zur Förderung (literar-)ästhetischen Lernens im Deutschunterricht, die im Rahmen der Lehrer:innenbildung entwickelt und empirisch evaluiert wird. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern ein autonomieunterstützendes Lehrveranstaltungsdesign die Motivation von Lehrpersonen stärkt, ästhetische Lernformen nachhaltig in ihren Unterricht zu integrieren.
Die Lehrveranstaltung ist als mehrstufiger, prozessorientierter Lernzyklus konzipiert: Nach einer theoretischen Einführung in zentrale Konzepte der literarischen Ästhetik, Bildwissenschaft, Kunstpädagogik und Phänomenologie entwickeln die Teilnehmenden gemeinsam eigene Unterrichtsszenarien und erproben diese in der schulischen Praxis. Den Abschluss bildet eine reflektierende Auswertung und Präsentation der Erfahrungen. Begleitet wird der gesamte Prozess durch ein kontinuierliches Mentoring, das die professionelle Entwicklung der Lehrpersonen gezielt unterstützt und fördert.
Im Rahmen eines Mixed-Methods-Designs wird untersucht, inwiefern die Intervention die Motivation zur Implementierung literarästheti-scher Lernformen stärkt, welche Elemente als besonders förderlich oder hemmend wahrgenommen werden und mit welchen individuellen Herausforderungen die Lehrpersonen bei der Planung und Umsetzung konfrontiert sind. Damit trägt das Projekt zur evidenzbasierten Weiterentwicklung literaturdidaktischer Lehr-Lern-Formate und zur nachhaltigen Verankerung ästhetischer Bildung in der Lehrer:innenausbildung bei.
Projektleitung: Schmölzer Bernhard
Laufzeit: 01.10.2022-30.06.2026
Projektleitung gesamt:
HS-Prof. Mag. Dr. Bernhard Schmölzer
Univ. Prof. Dr. David Kollosche
Projektleitung intern:
HS-Prof. Mag. Dr. Bernhard Schmölzer
Projektmitarbeiter:innen intern:
Dipl.-Ing.in Prof.inBarbara Bernhardt, BEd
Roman Brabec, BEd Dipl.Päd.
Prof. Mag. Gernot Glas
HS-Prof.in Dr.in Kathrin Holten
Ing. Jürgen Oberhauser, BEd
Prof.in Mag.a Marina Perterer
Laufzeit:
01.10.2022-30.09.2027
Projektbeschreibung:
Im Schuljahr 2022/2023 startete an ausgewählten österreichischen Mittelschulen in allen neun Bundesländern ein Schulversuch mit einem neuen Schulfach „MINT“. Die Abkürzung „MINT“ steht für einen Fächerkanon aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. „MINT“ wird von der 5. bis zur 8. Schulstufe (1. bis 4. Klasse) als fächerübergreifender und projektorientierter Unterrichtsgegenstand geführt. Alle Schüler:innen des MINT-Schulversuchs werden in der Sekundarstufe 1 in dem neuen interdisziplinären Gegenstand „MINT“ im Ausmaß von 11 bis 15 zusätzlichen Wochenstunden, beginnend mit der 5. Schulstufe, fächerübergreifend unterrichtet. Dafür wurde ein eigener Lehrplan entworfen. Der Schulversuch läuft über einen mehrjährigen Zeitraum (Schuljahr 2022/2023 bis längstens 2027/2028) und wird laufend evaluiert. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung (BMB) begleitet die Initiative IMST den Schulversuch. IMST steht für „Innovationen Machen Schulen Top“ und ist ein österreichweites Unterstützungssystem für die innovative Weiterentwicklung und Verbesserung des MINT-Unterrichts an Österreichs Schulen. Koordiniert wird IMST von der Pädagogischen Hochschule Kärnten und vom Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung (IUS) der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Ziel ist die Grundlegung einer fächerübergreifenden MINT-Didaktik als Orientierungsgrundlage. Darauf aufbauend wurden und werden Materialien für den MINT-Unterricht (fach-)didaktisch aufbereitet und entwickelt sowie erprobt und evaluiert. Diese werden den Schulen über digitale Lehr- und Lernportale (IMST-Website und Eduthek) fachdidaktisch kommentiert zur Verfügung gestellt.
Projektleitung gesamt:
HS-Prof. Univ.-Prof. Dr. Franco Finco
Prof. Dr. Luca Melchior | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Prof. Dr.Dr. Paolo Roseano | Universität Barcelona
Projektleitung intern:
HS-Prof. Univ.-Prof. Dr. Franco Finco
Projektmitarbeiter:innen intern:
HS-Profin Maga. Drin. Priv.-Dozin. Angela Fabris
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Balsemin, Tommaso; Dr. / Universität Frankfurt am Main
Cadorini, Giorgio; Prof. Dr. / Universität Masaryk, Brno, CZ
Casalicchio, Jan; Dr. / Universität Siena
Cordin, Patrizia; Prof. Dr. / Universität Trient
De Cia, Simone; Dr. / Universität Manchester, UK
Heinemann, Sabine; Prof. Dr. / Universität Graz
Magistro, Giuseppe; Dr. / Universität Gent, Belgien
Pescarini, Diego; Prof. Dr. / Universität Cote D'Azur, Nice
Turello, Davide; Dr. / Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Vanelli, Laura; Prof. Dr. / Universität Padua
Zanello, Gabriele; Prof. Dr. / Universität Udine
Laufzeit:
01.01.2021-31.12.2027
Fördergeber:
Regierung der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien, ARLeF Regionalagentur
Projektbeschreibung:
Das Friaulische ist eine autonome Sprache, die mit dem Dolomiten-Ladinischen und dem Bündnerromanischen die Gruppe der rätoromanischen Sprachen bildet. Friaulisch wird in der Region Friaul von mehr als 600.000 Menschen gesprochen. Mit der gesetzlichen Anerkennung des Friaulischen als historische Sprachminderheit Italiens (durch das Gesetz 482/1999) wird der Einführung des Friaulischen als Unterrichtssprache bzw. als Verkehrssprache in Kindergärten, Volksschule und an der Sekundarstufe I, sowie als Unterrichtsfach in letzterer eine legislative Legitimierung gegeben. Da das Friaulische eine „dachlose“ Minderheitensprache ist – d.h. eine Sprache ohne extraterritoriale Referenzvarietät – und auch keine fest verankerte interne Norm kennt, ergeben sich auch für dessen Einführung in das Bildungssystem besondere Herausforderungen. In Bezug auf den Korpusplanungssektor (Corpus planning) wurden in den letzten zwei Jahrzehnten einige Hauptziele (z. B. Rechtschreibcodierung) erreicht. Das Fehlen einiger didaktischer Instrumente, die für den Friaulischunterricht von vorrangiger Bedeutung sind, wird jedoch weiterhin von Lehrenden beklagt. Besonders wird das Fehlen einer sogenannten „Referenzgrammatik“ der friaulischen Sprache für den schulischen-didaktischen Gebrauch bemängelt. Die in einer solchen Referenzgrammatik erarbeiteten Regeln, wären das Ergebnis einer induktiven Verallgemeinerung, die aus empirischen Daten gewonnen und durch sie gesichert werden können, gesammelt und analysiert mit den theoretisch-methodischen Instrumenten der modernen sprachdidaktischen Forschung und Grammatikographie. Der besondere Fokus dabei liegt auf Fragestellungen zur Sprachdidaktik für alle Unterrichtsfächer im Kontext der Minderheitensprache. Das international angelegte Forschungsprojekt bietet die Möglichkeit, die PH Kärnten in diesem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der „Sprachdidaktik von Minderheitensprachen“ ins Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu setzten, denn für den Bereich der Didaktisierung von Minderheitensprachen im schulischen Kontext liegen kaum Forschungsergebnisse vor. Mit Hilfe dieses Forschungsprojektes kann eine exemplarische wissenschaftliche Grundlage (ein Instrumentarium) geschaffen werden, mit dessen Hilfe ein gesicherter Spracherwerb im Kontext von Lernen und Erlernen von Minderheitensprachen für das schulische Feld kodiert wird bzw. eine „Referenzgrammatik“ aufgebaut werden kann. Im Januar 2025 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen ARLeF und PHK für die zweite Phase des Forschungsprojekts unterzeichnet. In diesem Vertrag ist vorgesehen, dass die Forschungsergebnisse und die für die Referenzgrammatik erstellten Materialien in der Produktion von Lehrmaterialien (Lehr- und Handbücher, Übungen usw., sowohl in gedruckter als auch digitaler Form) verwendet und in die technologische Entwicklung von Werkzeugen wie automatischen Übersetzern, Programmen zur Sprachsynthese und -erkennung sowie Künstlicher Intelligenz implementiert werden. Laut dem Kooperationsvertrag wird diese weitere Phase des Forschungsprojekts gemeinsam mit ARLeF und INSIEL, dem IT-Dienstleister der Region Friaul-Julisch Venetien, entwickelt.
Projektleitung gesamt:
HS-Prof. Univ.-Prof. Dr. Franco Finco
Prof. Dr. Luca Melchior | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Projektleitung intern:
HS-Prof. Univ.-Prof. Dr. Franco Finco
Projektmitarbeiter:innen intern:
Mag.a OStRin Gabriele Isak
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Fusco, Fabiana; Prof. Dr. / Universität Udine, Italien
Menegale, Marcella; Prof. Dr. / Universität Ca’ Foscari Venedig, Italien
Laufzeit:
01.10.2021-31.12.2027
Fördergeber:
Regierung der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien
Projektbeschreibung:
Dieses Projekt befasst sich mit dem Unterricht lokaler deutscher Varietäten, die in den deutschen Sprachinseln in Friaul Julisch Venetien gesprochen werden: Plodn/Sappada, Zahre/Sauris und Tischlbong/Timau. Diese Sprachinseln am Südhang der Ostalpen stammen aus einer Besiedelung, die im 12. und 13. Jahrhundert stattfand. Mit dem italienischen Staatsgesetz 482/1999 wurden die Rechte autochthoner Sprachgruppen in Italien anerkannt und die Förderung ihrer Sprachen – unter anderem durch die Einführung in den Schulunterricht – zum Gesetzesziel erhoben. Aufgrund ihrer Isolation und geografischen Lage ist diesen Sprachinseln eine schwache bis gar keine sprachlich-kulturelle Orientierung am deutschsprachigen Raum gemeinsam, was dazu geführt hat, dass die jeweils gesprochene Sprache einerseits sehr archaisierend, andererseits von den sie umgebenden romanischen Varietäten beeinflusst ist, welche auch als High-Varieties dien(t)en, während die lokale deutsche Varietät der umgangssprachlichen Familien- und Dorfkommunikation vorbehalten war/ist und außer für eigenbezogene Themen kaum verschriftlicht war/ist (Baum 1980: 35 ff.). Darüber hinaus sind diese deutschen Sprachinseln eine Sprachminderheit innerhalb einer anderen Sprachminderheit, der friaulischen, zu der enge Beziehungen bestehen. Diese Tatsache stellt sich als Herausforderung bei der Umsetzung des Schulunterrichts dar. Das Forschungsprojekt basiert auf der Sammlung und Analyse von Daten, die in den drei deutschsprachigen Sprachinseln Friauls gesammelt werden. Das Hauptforschungsinstrument besteht aus Interviews mit Lehrer_nnen und Schulleiter_nnen sowie mit lokalen Kulturakteuren und Mitgliedern der Sprachgemeinschaft. Die Interviews werden auf der Grundlage eines Referenzfragebogens durchgeführt, lassen jedoch Raum für eine eingehendere Vertiefung einzelner Aspekte und Themen, die für die Forschung von Interesse sind. Die Sammlung und Analyse des verwendeten Unterrichtsmaterials, das häufig von Lehrer_innen erstellt wird. Diskussion von Problemen, Ergebnissen und möglichen Lösungen des Unterrichts in den lokalen deutschen Varietäten. Vorschlag eines Sprachbildungsmodells, dass das Lehren und Lernen lokaler deutscher Varietäten fördert, das nachhaltig, integrierbar in den Lehrplan und auf zukünftige Szenarien ausgerichtet ist.
Projektleitung gesamt:
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Corinna Koschmieder | PH Steiermark
Prof.in Mag.a Dr.in Unterköfler-Klatzer Dagmar | PH Kärnten
Projektmitarbeiter:innen:
HS-Prof.in MMag.a Dr.in Priv.-Doz.in Thomas Almut
Prof.in Mag.a Dr.in Strauß Sabine
Prof.in Mag.a Marie Bilalovic
Projektmitarbeiter:innen extern:
HS-Prof. Mag. Martin Auferbauer, PhD | PH Steiermark
HS-Prof. Mag. Mathias Krammer, MA PhD | PH Steiermark
Mag. Manfred Herzog MA | PH Steiermark
Laufzeit:
09.10.2021-01.03.2026
Projektbeschreibung:
TALIS (Teaching and Learning International Survey) ist eine weltweite, internationale Studie über das Lernumfeld an Schulen und die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern. Sie wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt und stellt die Perspektive der Lehrpersonen in den Mittelpunkt. Österreich nimmt nach 2008 und 2018 das dritte Mal an TALIS teil. Das Ziel von TALIS ist die Bereitstellung von Indikatoren und Analysen über die Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes Schule. Darüber hinaus ermöglicht TALIS einen Vergleich des schulischen Arbeitsumfelds der teilnehmenden Länder. Insbesondere sollen bei TALIS 2024 neben den Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern folgende Themenbereiche fokussiert werden: Lehrmethoden, -haltungen und -einstellungen sowie Unterricht in heterogenen Lernumfeldern, Arbeitszufriedenheit, Diversität, Nutzung digitaler Technologien und der Einfluss von COVID-19.
Website:
https://talis-oesterreich.at
Forschungspartner:
Pädagogische Hochschule Steiermark (Österreich)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, CERI Centre for Educational Research and Innovation (Frankreich)
Bundesministerium für Bildung und Frauen, Sektion III (Österreich)
IQS – Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (Österreich)
Projektleitung:
HS-Prof. Mag. Dr. Matthias Huber
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Christine Haupt, BA Med
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Sarah Moser, BEd
Andrea Stangl, BEd
Laura Steinkellner, BEd
Anna-Maria Sternat, BEd
Laufzeit:
01.10.2020-31.12.2026
Projektbeschreibung:
Das Forschungsprojekt „GSV Bildung“ widmet sich der zentralen Bedeutung von Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen im Bildungskontext. Im Mittelpunkt der multimethodischen und partizipativen Studie steht die Entwicklung eines Messinstruments in Form eines validen Kurzfragebogens zur Erfassung von Geborgenheit (als sekundäre und soziale Emotion) im Unterricht. Darüber hinaus soll die Studie durch ein konsekutives Mixed-Methods-Design die Analyse der zentralen Prädikatoren von Geborgenheit in Schule und Unterricht und in weiterer Folge die Ableitung evidenzbasierter Maßnahmen zur Förderung von Geborgenheit sowohl für die Primar- als auch für die Sekundarstufe ermöglichen. Damit versucht das Projekt einerseits drei zentralen Forschungsdesideraten der empirischen Schul- und Unterrichtsforschung entgegenzuwirken und möchte anderseits durch die Steigerung von Wohlbefinden und Lernfreude einen konstruktiven Beitrag zur Schulentwicklung im Pflichtschulbereich leisten.
Projektleitung:
HS-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Christian Pichler
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Cornelia Klepp
Projektmitarbeiter:innen:
HS-Prof.in MMag.a Dr.in Priv.-Doz.in Almut Thomas
Laufzeit:
02.11.2020-31.12.2026
Projektbeschreibung:
Die Geschichtsdidaktik hat „die Bedeutung einer professionell agierenden Lehrkraft für schulische Erfolge“ (Barsch/Barte 2021, 5) spät in den Blick genommen. Ein Grund dafür ist u. a. ihre eigene Wissenschaftsgeschichte. Sah sich die Geschichtsdidaktik ihrem Selbstverständnis nach zunächst als „Methoden- oder Erfahrungswissenschaft“, erkannte sie durch den PISA-Schock und die Hattie-Studie die Bedeutung fachlicher Mitwirkung an der Lehrer:innenbildung (Körber, 2021, 16). Die Sicht auf Professionalität als einer „genuinen“ Selbstverständlichkeit (vgl. Müller et al., 2018) bzw. als Teil eines allgemein gehaltenen Lehrer:innen-Begriffs (vgl. Weißenbacher et al., 2019) wurde in jüngerer Vergangenheit von zielgerichteter Forschungsarbeit zu fachlichen Facetten von Lehrkompetenzen abgelöst. Themen wie Professionswissen, Motivation, subjektive Theorien und Strategien zur Selbstregulation kamen auf die Agenda fachdidaktischer Theoriebildung, Empirie und Pragmatik (vgl. Bernhard, 2021). Das Projekt befasst sich mit der Genese und dem Erscheinungsbild eines domänenspezifischen Professionsverständnisses bei Kärntner Geschichtslehrer:innen. In mehreren Teilstudien wird anhand der genannten Kategorien untersucht, wie sich fachliche Professionalität entwickelt, darstellt und durch Ausbildung bzw. Praxiserfahrungen verändert. Dazu werden zwei Personengruppen analysiert: erfahrene Fachlehrer:innen und angehende Lehrpersonen. Richtet sich das Forschungsinteresse bei Ersteren auf deren Berufsbiografie und die wahrgenommenen Kontinuitäten bzw. Brüche sowie Entwicklungen während des Professionalisierungskontinuums, werden bei Zweiteren die Motivation zur Fachwahl, ihre Berufsvorstellungen, die Art der didaktischen Interventionen im Zuge der Ausbildung und deren Evidenz in den Lehrer:innenhandlungen (Schulpraxis und nach zwei Dienstjahren) analysiert. Ziel der Studien sind Aussagen zu fachlichen Effekten auf die Professionalität (Unterrichtshandlungen) durch die Lehrer:innenbildung NEU (aus 2015), die einen alternativen Typus von Lehrpersonen („Sekundarstufenlehrer:in“) angestrebt hat.
Projektleitung:
Prof.in Mag.a Dr.inSabine Buchwald
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Eva Hartmann, BEd MA
HS-Prof. MMag. Dr. Daniel Wutti, MSc
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Studierende der Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule (Transkription von Interviews)
Laufzeit:
31.12.2019-30.12.2025
Projektbeschreibung:
In Kooperation mit dem BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt werden im Rahmen des Forschungsprojekts auf der Sekundarstufe I zwei Interviewserien erfasst. Die erste Serie der Befragung umfasst 63 durchgeführte Interviews, in der zweiten Serie im Sommersemester 2023 finden 48 Interviews statt, ergänzt durch 19 Folgeinterviews aus 2021. Gegenstand der Forschung ist einerseits die Gewinnung von Informationen über den Sprachgebrauch, der die sprachliche Dominanz sowie den Hintergrund bilingualer und multilingualer Lernender veranschaulicht, andererseits richtet sich die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf die familiäre, institutionelle und gesellschaftlich-räumliche Sprachentwicklung sowie auf den bilingualen Unterricht auf elementarer und primärer Ebene. Die Erfassung der Sprachkompetenz der Lernenden basiert sowohl auf der Selbsteinschätzung ihres aktuellen Wissens in Slowenisch, Deutsch und gegebenenfalls weiteren Sprachen als auch auf der retrospektiven Beurteilung der sprachlichen Kompetenzen auf der Primarstufe. Ein weiteres Thema ist der emotionale Kontext von Sprachen. Neben der Auseinandersetzung mit den Eigenschaften und Funktionen von Sprachen werden auch emotionale und persönliche Faktoren beim Erwerb der ersten, zweiten und dritten Sprache, die Bedeutung und Wertschätzung von Sprache, die Lernmotivation sowie die Beziehung zu und Identifikation mit den gewählten Sprachen einbezogen.
Projektleitung:
HS-Prof.in MMag.a Dr.in Priv.-Doz.in Thomas Almut
Laufzeit:
01.10.2014-31.12.2025
Projektbeschreibung:
Lesekompetenz ist eine zentrale Voraussetzung für schulisches Lernen und gesellschaftliche Teilhabe. Dennoch zeigt ein erheblicher Anteil von Jugendlichen gegen Ende der Pflichtschulzeit unzureichende Lesefähigkeiten (Naumann, Artelt, Schneider & Stanat, 2010). Erste Leseerfahrungen und frühe Lesemotivation erweisen sich als bedeutsame Prädiktoren für den späteren Umgang mit Texten und den Erwerb von Lesekompetenz (Cunningham & Stanovich, 1997). Neben Lesemotivation ist auch das fachspezifische Selbstkonzept ein wichtiger Faktor für schulische Leistungen (Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller & Baumert, 2005).
Das Projekt untersucht in einem längsschnittlichen Design (erste bis vierte Klasse) kausale Effekte von intrinsischer Lesemotivation, identifizierter Regulation und lesespezifischem Selbstkonzept auf Lesekompetenz. Erfasst werden Lesemotivation (SMR1–3; Thomas & Müller, 2016), Selbstkonzept (PIRLS, 2011), Leseverhalten (PIRLS, 2011) sowie Lesekompetenz (ELFE 1–6, Lenhard & Schneider, 2006; HAMLET 3-4). Vier Messzeitpunkte am Ende jedes Schuljahres ermöglichen die Analyse von Entwicklungsverläufen und Zusammenhängen.
Im Zentrum stehen folgende Fragen: (1) Wirken sich Lesemotivation und Selbstkonzept kausal auf Lesekompetenz aus? (2) Vermittelt Leseverhalten diesen Zusammenhang? (3) Ab wann kann Lesemotivation valide erfasst werden? Zur Beantwortung werden längsschnittliche Strukturgleichungsmodelle (RI-CLPM, Latent Growth Models) sowie Mediationsanalysen eingesetzt.
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Klärung motivationaler Einflussfaktoren in der frühen Leseentwicklung. Ergebnisse liefern theoretische Erkenntnisse über reziproke Zusammenhänge von Motivation, Selbstkonzept und Lesekompetenz und haben praktische Implikationen für die Förderung von Lesemotivation und Leseverhalten im Grundschulunterricht.
Cunningham, A. E., & Stanovich, K. E. (1997). Early reading acquisition and its relation to reading experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33(6), 934–945. https://doi.org/10.1037/0012-1649.33.6.934
Lenhard, W., & Schneider, W. (2006). ELFE 1–6: Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. Hogrefe.
Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O., & Baumert, J. (2005). Academic self-concept, interest, grades, and standardized test scores: Reciprocal effects models. Child Development, 76(2), 397–416. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00853.x
Naumann, J., Artelt, C., Schneider, W., & Stanat, P. (2010). Lesekompetenz von Jugendlichen im internationalen Vergleich. In E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O. Köller, M. Prenzel, & P. Stanat (Hrsg.), PISA 2009: Bilanz nach einem Jahrzehnt (S. 23–71). Waxmann.
Thomas, A. E., & Müller, F. H. (2016). Entwicklung und Validierung der Skalen zur motivationalen Regulation beim Lernen. Diagnostica, 62(2), 74–84. doi.org/10.1026/0012-1924/a000137
Projektleitung:
Prof.in Mag.a Dr.inMonika Raffelsberger-Raup, Bakk.
Projektmitarbeiter:innen:
Prof.in Mag.aChristine Prochazka, BEd MA
Projektlaufzeit:
01.10.2025-29.02.2028
Projektbeschreibung:
Aufgaben gelten in der fachdidaktischen Diskussion als zentrales Medium zur Vermittlung zwischen Lerngegenstand, Schüler:innen und Lehrperson. Sie sind damit nicht nur methodisches Hilfsmittel, sondern das „zentrale Mittel zur Gestaltung des Unterrichts“ (Neubrand et al. 2011). Mit dem Pädagogikpaket des BMBWF (2025) wurde der Einsatz von Lernaufgaben zudem als eine der sieben zentralen Maßnahmen für qualitätsvollen Unterricht hervorgehoben. Lehrpersonen – insbesondere im Fach Deutsch – stehen vor der Aufgabe, kompetenzorientiert und integrativ zu unterrichten sowie zentrale Themenbereiche des Faches und fächerübergreifende Inhalte in ihre Unterrichtsgestaltung einzubeziehen. Da bislang jedoch nur wenige konkrete Handreichungen zur Umsetzung von Aufgabenarrangements im Deutschunterricht vorliegen, besteht ein deutlicher Bedarf an praxisnaher Unterstützung.
Das Projekt verfolgt daher zwei zentrale Ziele: Erstens werden angehende Lehrpersonen im Rahmen fachdidaktischer Lehrveranstaltungen bei der Entwicklung, Erprobung und Reflexion von Aufgabenarrangements begleitet. In diesem Zusammenhang soll auch beforscht werden, inwieweit die Arbeit an Aufgabenarrangements die studentische Vorstellung von fachdidaktischen Konzeptionen verändert. Damit rückt neben der Praxisentwicklung auch die Professionalisierung der Lehramtsstudierenden in den Blick. Zweitens wird auf Grundlage der Erfahrungen eine praxisorientierte Handreichung für Lehrkräfte entwickelt, die konkrete Beispiele und Orientierungspunkte bereitstellt und längerfristig auch in die Lehrer:innenfortbildung Eingang finden soll.
Projektleitung:
Prof.in Mag.a Dr.in Heike Demarle-Meusel
Projektmitarbeiter:innen:
Prof.in Mag.a Dr.in Cornelia Klepp
Prof.in Marie-Helen Kitz, BA MA
Prof.in MMag.a Damaris Schwarzfurtner
Projektlaufzeit:
01.10.2025-30.09.2028
Projektbeschreibung:
Das neue Curriculum zum Bachelorstudium Primarstufe basiert auf dem von Huber und Claußen (2024) entwickelten Rahmenmodell professionsbezogener Kompetenzentwicklung, das sechs zentrale Kompetenzbereiche definiert und entlang disziplinübergreifender Bildungsziele systematisiert ist. Diese Kompetenzmatrix diente als konzeptionelle Grundlage für die kompetenzorientierte Neugestaltung des Curriculums und ermöglicht eine kohärente Abbildung der Professionalisierungsziele der Lehrer:innenbildung.
Das Rahmenmodell von Huber und Claußen greift zentrale Dimensionen des COACTIV-Modells von Baumert und Kunter (2006) auf – insbesondere Professionswissen, Überzeugungen, Motivation und Selbstregulation –, überführt diese jedoch in eine bildungswissenschaftlich begründete und curricular umsetzbare Struktur. Während COACTIV diese Kompetenzbereiche empirisch differenziert beschreibt und durch validierte Messinstrumente operationalisiert, liegt der Fokus des Modells von Huber und Claußen auf der curricularen Verankerung und hochschuldidaktischen Umsetzung. Für das vorliegende Forschungsvorhaben bildet COACTIV daher die geeignete theoretisch-empirische Grundlage, um die Entwicklung professioneller Kompetenzen systematisch zu untersuchen und mit bestehenden Messverfahren abzubilden.
Durch die Umsetzung des neuen Bachelorstudiums Primarstufe mit Beginn des Studienjahres 2025/26 bietet sich die Chance, eine Studierendenkohorte von Beginn an hinsichtlich ihres individuellen Kompetenzaufbaus im Rahmen des sechssemestrigen Studiums zu beforschen. Im Rahmen eines Mixed-Methods-Designs werden zu verschiedenen Zeitpunkten sowohl qualitative als auch quantitative Befragungen durchgeführt. Die Kohorte 1 wird im Sinne einer Längsschnittstudie über mehrere Erhebungszeitpunkte hinweg kontinuierlich begleitet, um individuelle Entwicklungsverläufe und zeitliche Veränderungen zu analysieren. Ergänzend dazu erfolgt eine querschnittliche Auswertung der Kohorten 1, 2 und 3 zu den Messzeitpunkten T1 und T2, um gruppenspezifische Unterschiede der jeweiligen Erhebungszeitpunkte vergleichend zu betrachten. Das Projekt soll die Wirkmächtigkeit der neuen Ausbildung bezogen auf die Professionsentwicklung der Studierenden aufzeigen und wesentliche Erkenntnisse darüber liefern, ob die Passung zwischen curricularen Vorgaben (anhand eines zugrunde liegenden Kompetenzmodells) und dem Studium (Aufbau und Inhalte der Lehrveranstaltungen) zu einem Kompetenzaufbau bei den Studierenden führt.
Projektleitung gesamt:
Prof.in Nadja Julia Kupper, BSc, MSc, PhD
Projektmitarbeiter:innen intern:
HS-Prof.in Dr.in Kathrin Holten
Dipl.Päd. Roman Brabec, BEd
HS-Prof. Mag. Dr. Bernhard Schmölzer
Dipl.-Ing. Georg Sitter, BEd BSc.
Laufzeit:
01.10.2025-30.09.2029
Projektbeschreibung:
Im Fokus des wissenschaftlichen Projektes steht die Begleitung und Evaluierung des Hochschullehrgangs MINT. Ziel der Forschung ist es, Erkenntnisse zur Wirkung, Qualität und Weiterentwicklung des Lehrgangs zu gewinnen. Dies geschieht insbesondere im Hinblick auf die MINT-Kompetenzerweiterung, die Motivation und die schulischen Praxisbezüge. Die gewonnenen Ergebnisse werden zur Weiterentwicklung des Lehrgangs und zur Qualitätssicherung von MINT-Fortbildungen herangezogen.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, wie Lehrkräfte den Lehrgang erleben, welche Inhalte sie als besonders relevant empfinden und welche Bedingungen die Umsetzung im Schulalltag unterstützen oder erschweren.
Zu diesem Zweck werden verschiedene Perspektiven erhoben und ausgewertet, um ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie eine praxisnahe und wirksame MINT-Fortbildung gestaltet sein kann.
Das Projekt trägt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Lehrgangs bei und setzt darüber hinaus Impulse für die Professionalisierung der Lehrer:innenbildung im MINT-Bereich. Das langfristige Ziel besteht in der nachhaltigen Stärkung des MINT-Unterrichts an Schulen.
Projektleitung:
Prof.in Mag.aElisabeth Nuart, BA
Projektmitarbeiter:innen:
Prof.in Mag.a Dr.in Maria Eder-Eichberger
Laufzeit:
01.10.2025-31.07.2028
Projektbeschreibung:
Das Forschungsprojekt fokussiert Zusammenhänge der Professionalisierung elementarpädagogischen Handelns ausgehend von einem Verständnis von Professionalisierung als reziproken Prozess individueller Professionalisierung in berufsbiografischer Perspektive und kollektiver Professionalisierung, im Sinne der ermöglichenden Strukturen und Rahmenbedingungen inklusive der organisationskulturellen Aspekte bis hin zu kollektiv erzeugten Handlungsorientierungen elementarpädagogischer Praxis.
Der Berufseinstieg wird hierbei als eine Phase angenommen, in der Unterschiede in den Handlungsorientierungen zwischen Berufseinsteiger:in und etablierten Fachkräften besonders deutlich wahrgenommen werden und bearbeitet werden müssen. Für die Art und Weise der Bearbeitung spielen, so die Annahme, unterschiedliche Rahmenbedingungen und organisationskulturelle Aspekte eine Rolle.
Ziel des Forschungsprojektes ist es diese Zusammenhänge aus der Perspektive der Berufseinsteiger:innen auf Basis narrativer Interviews zu rekonstruieren und hilfreiche Bedingungen für ein produktives Zusammenspiel individueller und kollektiver Professionalisierung zu identifizieren.
Projektleitung gesamt:
Prof.in Mag.a Martina Kalkhof, PH Steiermark
Projektleitung intern:
Prof.in Mag.aElisabeth Nuart, BA
Projektmitarbeiter:innen intern:
Prof.in Mag.a Dr.in Maria Eder-Eichberger
Weitere Projektmitarbeiter:innen:
Prof.in Mag.a Gerda Guttmann-Klein, PH Steiermark
Anja Werfring, BEd MA, PH Burgenland
Tanja Leberl, BA MA, PH Burgenland
Projektlaufzeit:
01.10.2025 – 30.09.2028
Projektbeschreibung:
Mit der kürzlichen Verlagerung der Ausbildung zum:zur Inklusiven Elementarpädagog:in an die Pädagogischen Hochschulen und der Einführung eines berufsfeldspezifischen Bachelorstudiums für Inklusive Elementarpädagogik rücken das Professionsverständnis und die Rollenerwartungen hinsichtlich dieser Berufsgruppe verstärkt in den Blick.
Das vorliegende Forschungsprojekt erforscht auf Basis von bundeslandübergreifenden Gesetzen und pädagogischen Leitprinzipien sowie bundeslandspezifischen Rahmenbedingungen und Charakteristika Aspekte des Professionsverständnisses Inklusiver Elementarpädagog:innen. Über eine Erhebung der Perspektiven unterschiedlicher Akteur:innen sollen handlungsleitende Vorstellungen über die Rollen, Aufgaben und professionellen Arbeitsweisen Inklusiver Elementarpädagog:innen herausgearbeitet und deren Bedeutung für die Professionalisierung des Berufsfeldes erkundet werden.
Mittels Leitfadeninterviews werden in den Bundesländern Burgenland, Kärnten und der Steiermark Elementarpädagog:innen, Leitungen von elementaren Bildungseinrichtungen, Verantwortliche auf Ebene der Träger:innen und Landesverwaltung, sowie Inklusive Elementarpädagog:innen selbst hinsichtlich der Umsetzung inklusiver Bildung und der damit verbundenen Professions- und Rollenverständnisse Inklusiver Elementarpädagog:innen befragt. In einer zweiten Phase werden die Ergebnisse dann in Fokusgruppen mit Inklusiven Elementarpädagog:innen in den drei Bundesländern diskutiert, um Bedeutungen von und Umgangsweisen mit den Professions- und Rollenverständnissen zu erkennen. Die erhobenen Daten werden jeweils qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet.
Ziel ist es, über den Zugang zu Professions- und Rollenverständnissen Chancen und Herausforderungen hinsichtlich der Professionalität und der weiteren Professionalisierung des Berufsfeldes aufzudecken. Darüber hinaus sollen Einblicke in das Zusammenwirken von Rollenverständnissen im individuellen sowie kollektiven Sinne vor dem Hintergrund institutioneller und rechtlich verankerter Grundlagen gewonnen werden.